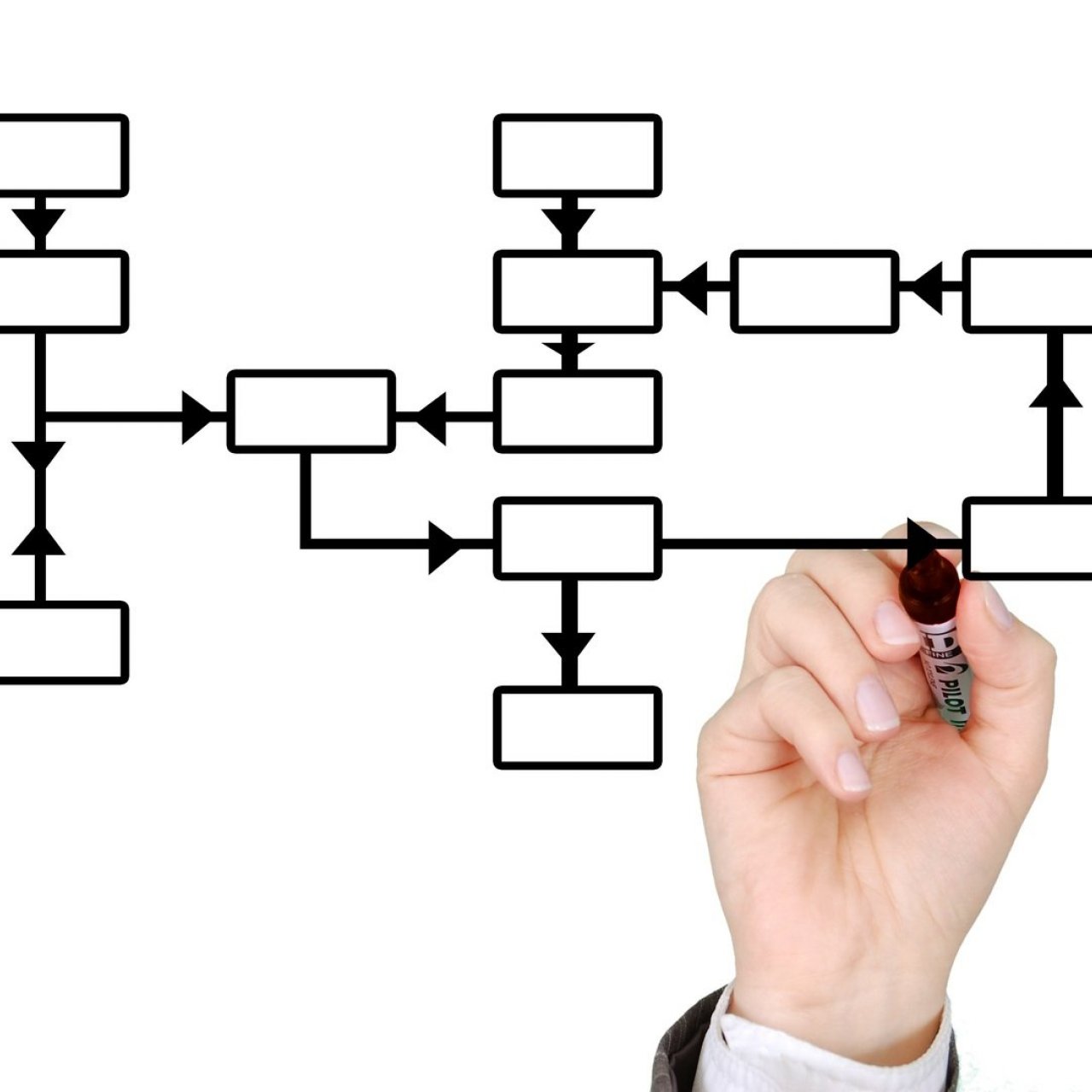Die unsichtbare Seite einer Fusion
Fusionen gelten im Management als besonders komplizierte, aber irgendwie planbare Vorhaben. Auf dem Papier scheint vieles machbar: Verträge werden geschlossen, Organigramme harmonisiert, Prozesse zusammengeführt, IT-Systeme integriert. Doch jenseits dieser technischen Vollzüge beginnt eine Phase, die sich deutlich widerspenstiger zeigt: die soziale Integration. Hier treffen unterschiedliche Kulturen, Perspektiven und Routinen – Kurzum eine Vielzahl unterschiedlicher Erwartungen aufeinander, die sich nicht einfach per Dekret anpassen oder durch Change-Kampagnen "wegkommunizieren" lassen. Wer hier auf Change-Management-Folklore setzt, bleibt wirkungslos. In diesem Artikel bieten wir einen anderen Blick und damit auch wirksamere Ansätze, um Fusionen zu verstehen und zu begleiten. Dabei beleuchten wir besonders 4 Phänomene:
- Erwartungsbildung in Organisation im Fusionskontext
- Rationalitätserwartungen und Organisationsrealität
- Grenzmanagement als Kerndisziplin
- Kommunikation ist nicht gleich Kommunikation
Fusion oder Integration oder aus zwei macht eins?
Organisationen sind – systemtheoretisch nach Luhmann gedacht – keine Maschinen, sondern soziale Systeme, die durch Kommunikation entstehen und sich durch Kommunikation reproduzieren. Jede Organisation entwickelt im Laufe der Zeit spezifische Routinen: Wie wird entschieden? Was gilt als legitim? Wer spricht mit wem, wann – und worüber? Werden Führungskräfte eher als Coaches oder als Autoritäten verstanden? Welchen Umgang wird bei Normabweichungen gewählt? Widerspricht man der Hierarchie oder nicht?
All das sind keine trivialen Fragen, sondern hochwirksame Koordinationsmechanismen, die sich im Laufe der Zeit ausbilden und dem Organisationssystem ihre eigene Form geben. Diese Mechanismen sind Strukturen, die der Stabilisierung von Erwartungen dienen – Erwartungsstrukturen. Sie schränken Komplexität (im Sinne: Was alles im Rahmen der Selbstorganisation der jeweiligen Organisation möglich ist) ein, und sind damit die Voraussetzung für den Aufbau eigener Komplexität.
Erwartungsbildung – die unsichtbare Seite der Fusion
Systemtheoretisch betrachtet sind Erwartungen und deren Stabilisierung der Dreh- und Angelpunkt sozialer Ordnungsbildung. Organisationen funktionieren, weil ihre Mitglieder sich darauf verlassen können, wie bestimmte Situationen typischerweise „gelöst“ oder „bearbeitet“ werden. Damit Erwartungen nicht fortwährend ausgesprochen werden müssen, bilden Organisationen Strukturen aus, die sie auf Dauer über die Mitgliedschaftsbedingung stabilisieren. Mit diesem zentralen Hebel entfaltet sich die Wirksamkeit von Organisationen.
Diese Erwartungsstrukturen bilden sich auf unterschiedlichen Wegen. Einerseits definieren formale Rahmenbedingungen wie Ziele, Zeichnungsbefugnisse, Regeln und KPIs ausdrücklich, welches Verhalten korrekt ist. Andererseits prägen abstrakte Werte (z.B. Nachhaltigkeit, Innovation, Wertschätzung) eher generelle Haltungen, die ebenso Orientierung geben. Im Schatten der formalen Organisation lassen sich informelle Erwartungsstrukturen beobachten. Ein anschauliches Bild liefert die Parallele zum Stadtpark: Offizielle Wege werden angelegt, aber Spaziergänger:innen treten auch Trampelpfade ins Gras – dazu braucht es kein Schild, sondern einfach die wiederholte Nutzung. Sind diese Pfade erst einmal ausgeprägt, kann sich die Erwartung, sie zu benutzen, ebenso stark ausbilden wie die Erwartung, die offiziellen Wege zu nehmen (und auch: mit wem welcher Weg gegangen werden kann oder in wessen Anwesenheit die Trampelpfade eher gemieden werden sollten). Wer sich einen Überblick über Erwartungsstrukturen und Entscheidungsprämissen machen will, den empfehle ich unseren weiterführenden Artikel zu Organisationsstrukturen.
Durch Strukturen und Mitgliedschaftsbedingungen finden Organisationen einen Umgang mit der Komplexität sozialen Zusammenwirkens, dass sich vor allem in einem Phänomen zeigt, das Talcott Parsons doppelte Kontingenz nannte. In jeder sozialen Situation müssen die Beteiligten sowohl eigene Verhaltensmöglichkeiten wie auch die (mögliche) Reaktion der anderen antizipieren. Erst wenn A erwartet, dass B grüßt, und gleichzeitig A weiß, dass B erwartet, selbst gegrüßt zu werden, entsteht ein stabiles Muster (oder wenn A weiß, das B nicht zurückgrüßt und dennoch erwartet gegrüßt zu werden, die Variationen, die stabilisiert werden können, sind vielfältig). In Organisationen stellt z.B. die formale Rolle Vorgesetzte:r Erwartungen klar, so dass eine Führungskraft nicht alltäglich auf den eigenen Status pochen muss, wenn es darum geht eine Entscheidung gegen den Willen anderer durchzusetzen.
Fusionen stören diese Gleichgewichte. In der Übergangsphase herrscht eine Art Erwartungs-Vakuum: Die alten Routinen gelten nicht mehr uneingeschränkt – aber neue haben sich noch nicht etabliert. Was ist jetzt ein „guter“ Projektplan? Wann eskaliert man eine Entscheidung – und an wen? Was wird als Initiative gesehen – und was als unbotmäßiger Alleingang? Und gerade in stressigen Momenten schlägt das „Alte“ durch. Früher, vor der Fusion, hat es doch wirksam funktioniert!
Die rationale Organisation ist eine Märchenerzählung
Wenn zwei Organisationen fusionieren, sei es durch Übernahme, Zusammenlegung oder Integration in einen Konzern, treffen zwei etablierte Erwartungsstruktur-Welten aufeinander. Beide Organisationen haben ihre eigenen Muster über die Zeit stabilisiert und kultiviert. Schnell wird hier auf die Rationalität der Organisation und ihrer Mitglieder verwiesen. In Führungsetagen hört man schnell den Satz: „Auch die in der Produktion werden die Vorteile der Fusion bald bemerken“, doch das Gegenteil ist der Fall. Was für das Top-Management ein relevantes Erfolgskriterium ist, muss für eine Produktionsabteilung kein lokales Erfolgskriterium sein. Dahinter verbirgt sich der weitverbreitete Irrtum, dass es in Organisationen eine Art übergeordnete Rationalität gäbe. Ausgehend von einem mehr oder minder stark formulierten Oberzweck lassen sich alle Unter-Zwecke wie Puzzleteile zusammenbauen. Doch die Realität von Organisationen ist eine andere, und die Praktiker:innen, die diesen Text lesen, werden ihre Organisation wiedererkennen. Organisationen sind Systeme mit begrenzter, lokaler Rationalität ihrer Einheiten (dazu mehr Herbert Simons - Bounded Rationality). Diese Rationalität basiert auf unterschiedlichen Zielen, die dann zu einem eigenen Richtig bzw. Falsch führt. So interpretiert eine Buchhaltungsabteilung Genauigkeit völlig anders, als das die Marketingabteilung macht. Und das ist kein Defekt der Organisation, sondern das Grundprinzip ihrer Leistungsfähigkeit (Stefan Kühl).
Treffen im Zuge einer Fusion also zwei Organisationen aufeinander, wirbelt das die gemachten Nester sämtlicher Organisationseinheiten ordentlich durcheinander. Die Fusion bringt einen neuen Zweck auf das Parkett, ob dieser nun Wachstum und Marktanteile, Benefit for the people oder Synergieeffekte heißt - und damit ist man direkt in der Paradoxie. Einerseits braucht es diese Überfrachtung mit Hoffnungen für eine glorreiche Zukunft der gesamten Organisation, sonst würde die Fusion wahrscheinlich gar nicht zustande kommen und gleichzeitig haben lokale Einheiten aufgrund ihrer lokalen Begrenztheit einen anderen Bezugsrahmen. Das kluge Management dieser Schauseiten von zwei Organisationen und ihren lokalen Einheiten, sowie der ganz eigenen Schauseite des Fusionsvorhaben wird zur Königsdisziplin.
Der Mythos vom Wir – Grenzmanagement wird zur Kerndisziplin in der Fusion
Jede Organisation erzeugt Grenzen gegenüber ihren relevanten Umwelten, sonst würde sie in ihrer Umwelt verschwimmen und aufhören zu existieren. Diese Grenzen sind kommunikativ und ermöglichen, sich als eigenständige Kommunikationssysteme von ihrer Umwelt zu unterscheiden und gleichzeitig zu verbinden. Grenzziehung ist also paradox. Sie stiften Verbindung, eben weil sie trennen oder in anderen Worten: Erst weil sich eine Organisation von ihrer Konkurrenz oder ihren Kunden unterscheidet, kann sie mit diesen Kooperationen aushandeln oder Produkte anbieten. In Fusionsprozessen werden etablierte System-/Umweltgrenzen herausgefordert. Die Schauseite beider Organisationen verliert an stabilisierender Wirkung, der Blick hinter Fassaden wird möglich, der formale Dschungel sichtbarer und damit undurchsichtiger. Wo zuvor Organisationszugehörigkeit, eigene Kunden und Produkte die Grenzbildung unterstützt hat, sind es jetzt Gehaltsunterschiede, Standorte oder neue Produktzuteilungen. Kurzum, Grenzen verschieben sich, sie oszillieren aber lösen sich nicht auf. Schnell hört man Sätze wie „Wir brauchen mehr Wir“ oder „Weniger gegeneinander und mehr Einheit“, von den Beteiligten. Das ist verständlich, doch entscheidend ist: Grenzen in Organisationen sind nicht nur trennend, sie sind auch verbindend. Sie machen Kooperation möglich, weil sie Zuständigkeiten und Unterschiede kenntlich machen. In einer Fusion ist es daher nicht zielführend, Unterschiede und Grenzmarkierungen abschaffen zu wollen. Vielmehr geht es darum, neue Grenzziehungen sichtbar zu machen und das Management von Grenzen zur Kernaufgabe zu erklären.
Es braucht ein anderes Verständnis von Kommunikation
Ausgehend von einem traditionell, rationalen Managementverständnis wird in vielen Fusionsprojekten proaktiv versucht, entstehende Unsicherheiten durch klare Kommunikation, frühes Setzen von Zielen oder Change-Kampagnen aufzulösen. Dass dieser Ansatz unserer Erfahrung nach zu kurz greift, liegt an einem völlig anderem Verständnis von Kommunikation.
Im Alltagsverständnis ist Kommunikation ein Akt zwischen Sender und Empfänger, zwischen Personen mit Absichten. In der Systemtheorie Luhmanns hingegen bezeichnet Kommunikation einen sozialen Prozess, der sich nur dort stabilisiert, wo Anschlusskommunikation erfolgt. Das heißt: Es wird nicht relevant, was gesagt wurde, sondern was anschlussfähig ist. Neue Erwartungen (in Form von Regeln, Hierarchien, Rollen, Zugehörigkeiten) können kommuniziert werden – aber sie werden kommunikativ erst wirksam, wenn sie beobachtbar (als Verhalten) praktiziert werden. Praktisch bedeutet das: Erwartungen (z.B. an neue Arbeitsweisen oder Entscheidungsbefugnisse) lassen sich nicht auf Knopfdruck durch "gute Kommunikation" ändern. Ob eine formale Richtlinie greift, entscheidet nicht die Richtlinie selbst, sondern ob im Alltag ein anderes, erwartungskonformes Verhalten beobachtbar wiederholt wird.
Fusion als Zone erhöhter Komplexität
Der Soziologe Dirk Baecker hat einmal geschrieben: „Komplexität ist nicht das Problem, sie ist die Lösung.“ Gemeint ist: Organisationen funktionieren nur deshalb, weil sie Umwelt-Komplexität in eigene Komplexität überführen können und damit Komplexität nicht eliminieren, sondern in bearbeitbare Formen überführen. Fusionen sind in diesem Sinne eine Phase radikal erhöhter Komplexität – weil sich alte Routinen auflösen, beide Organisationen sich bisher aus einer anderen System-Umwelt-Differenzen begriffen haben und es aktuell noch keine neue Form gibt. Die Vielzahl der Möglichkeiten steigt - nur wie, und welche Begrenzungen greifen nun?
Statt die Fusion mit der Unterschrift als erledigt zu markieren, braucht die neue Organisation, ihre Einheiten und auch die beteiligten Mitarbeitenden vor allem Zeit. Dabei hilft es, die Fusion oder Integration selbst als Übergangsprozess zu verstehen und in der Kommunikation entsprechend zu rahmen. Der Fokus auf eine erfolgreiche Fusion oder Integration bildet einen völlig anderen Erwartungshorizont, als wenn sofort Marge, Effizienz oder anderes im Vordergrund steht. Darin liegt kein Mangel, sondern eine notwendige Bedingung, damit neue Strukturen wirklich anschlussfähig werden, sich neue gruppendynamische Muster in den Teams eingeschwungen haben und Mitarbeitende sich in dieser neuen Organisation zurechtfinden.
Führungskräfte und Fusionen
Aus systemtheoretischer Sicht bedeutet Fusion oder Integration nicht, dass zwei Organisationen „eins“ werden – sondern dass sich neue Formen des Miteinanders entwickeln, in der Unterschiede auch sichtbar bleiben. Integrieren heißt nicht Harmonisieren, sondern Organisation von Anschlussfähigkeit. Führungskräfte können diesen Prozess dahingehend unterstützen, indem
- Räume zum Lernen explizit gerahmt werden und dadurch formalen Schutz erhalten;
- Unterschiede nicht als Defekt oder mangelndes Wir-Verständnis bewertet werden, sondern über deren Funktion und Folgen gesprochen und auch gestritten werden darf;
- sie die kommunikativen Bezugsrahmen stets überprüfen - die Vorgabe "Es ändert sich nichts", wird schnell zum Bumerang;
Die Rolle von Beratung in Fusionsprozessen
Was bedeutet das für Beratungsprozesse? Wir meinen, Beratung liefert keine Lösung, sondern hilft bei der Selbstbeobachtung, Bewertung und Erklärung auftretender Phänomene. In Fusionen heißt das konkret: Die Aufgabe der Beratung ist nicht, einen reibungslosen Übergang zu inszenieren, sondern Übergänge sichtbar zu machen. Die Irritationen, die sich zeigen – in Projektroutinen, in Entscheidungswegen, in Meetings – sind Hinweise auf unterschiedliche Erwartungslogiken.
Fazit: Integration beginnt mit Irritation
Fusionen sind keine technischen Projekte, sondern soziale Experimente in der Arbeit. Sie sind nicht dann erfolgreich, wenn alles glatt läuft – sondern wenn Organisationen lernen, mit neuen Unsicherheiten umzugehen. Systemtheorie liefert dafür kein „How-to“, aber Landkarten und Handwerkszeug, um zu verstehen, warum es so knirscht – und wie man produktiv damit umgehen kann.
Wer Fusionen gestalten will, braucht mehr als Change-Kommunikation: Es braucht einen genauen Blick für Erwartungsbildung, die Geduld, neue Routinen entstehen zu lassen – und die Fähigkeit, Widersprüche nicht als Problem, sondern als Möglichkeitsraum zu sehen
Literaturhinweise:
- Stefan Kühl - Von der Suche nach Rationalität zur Arbeit an Dilemmata und Paradoxen, weiterführend Herbert A. Simon (Theories of decision making in economics and behavioural science)
- Niklas Luhmann - Soziale Systeme S. 184, - weiterführend Talcott Parsons
- Dirk Baecker - Fehldiagnose „Überkomplexität", gdi-impuls 4, S. 55–62
- Foto von Dynamic Wang auf Unsplash