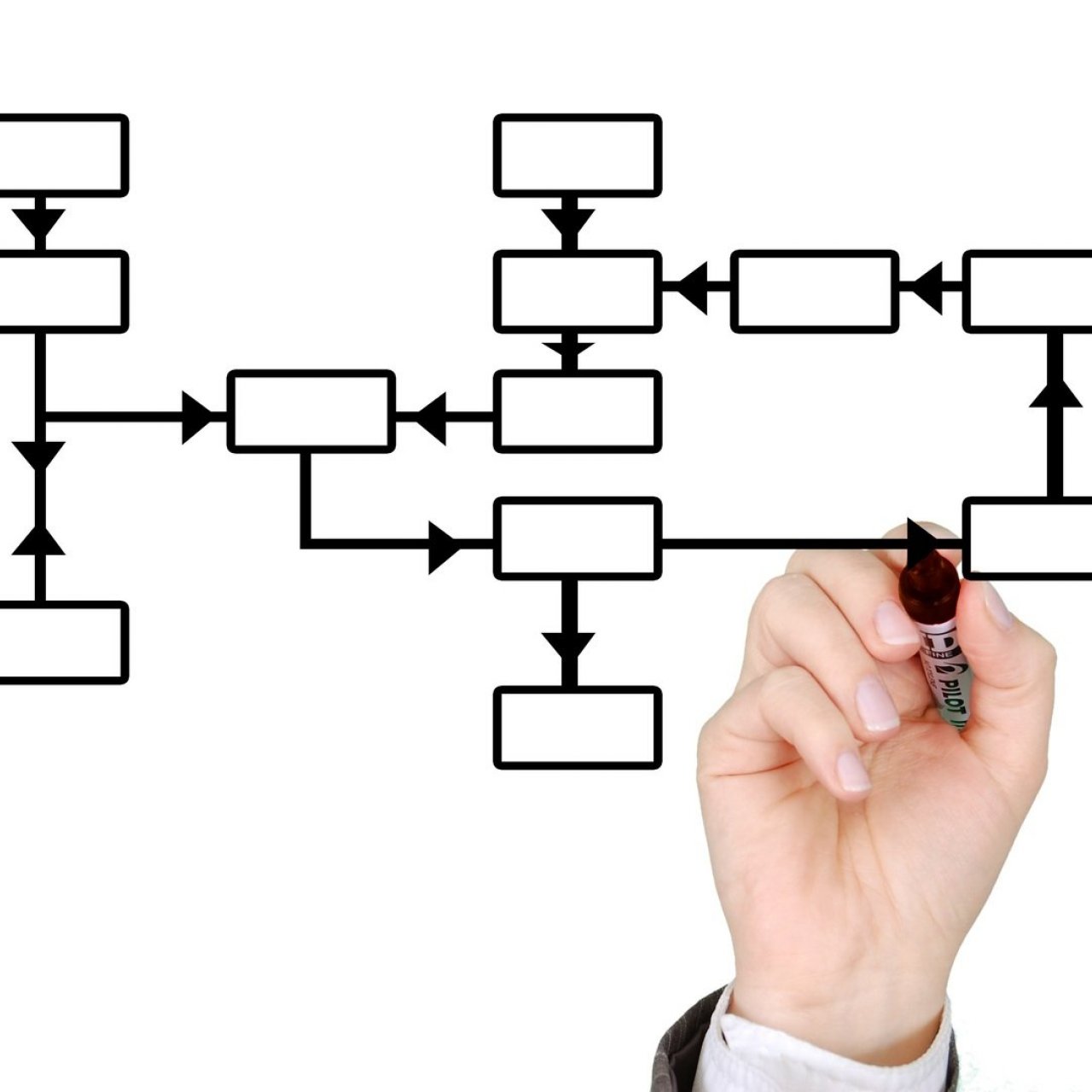OKR – Was wir erwarten, bestimmt, was wir erleben
Neugier, Frust, fehlende Teammotivation – von diesen und anderen gemischten Emotionen hörten wir in unserem Webinar “Zielorientiert Arbeiten – Verliebt in OKRs?!” Und tatsächlich bringen OKRs vieles in Bewegung: Strukturen, Routinen, Erwartungen. Und manchmal eben auch Emotionen.
Dieser Artikel beleuchtet, was wirklich passiert, wenn OKRs eingeführt werden und warum Erwartungen an die Methode oft nicht erfüllt werden. Zugleich geht es darum, was wir tatsächlich von OKRs erwarten können und wie sie dann, mit einer passenden Erwartungshaltung, wirksam werden können.
Nicht die Frage, wie OKRs ‚richtig‘ funktionieren, steht für uns im Vordergrund. Uns interessiert vielmehr, was in Organisationen geschieht, wenn Steuerungsimpulse wie OKRs eingeführt werden: Welche Verschiebungen ergeben sich im Gefüge von Erwartungen? Und welche Ergebnisse lassen sich realistisch erwarten – jenseits verheißungsvoller Heilsversprechen?
OKRs und der blinde Fleck der Erwartungen
Organisationen bestehen nicht einfach aus Menschen, Prozessen und Tools. Ihr zentrales Medium sind Entscheidungen. Doch Entscheidungen entstehen nicht im luftleeren Raum. Sie werden durch Erwartungen gerahmt: Erwartungen etwa darüber, was überhaupt entscheidungsrelevant ist, wer entscheiden darf, was als Erfolg gilt und welche Routinen als selbstverständlich vorausgesetzt werden.
Diese Erwartungsstrukturen sind oft unausgesprochen und informell. Sie finden sich selten in Handbüchern oder Organigrammen, prägen aber Verhalten und Entscheidungen nachhaltig. Zugleich bilden sie den Rahmen dafür, in welchem Maß Organisationen anschlussfähig kommunizieren und handlungsfähig bleiben.
OKRs greifen in diese Erwartungsstrukturen ein. Sie verschieben, was in einer Organisation als relevant gilt und verändern damit auch die Formen der Verständigung: worauf Aufmerksamkeit gerichtet wird, wie Führung wahrgenommen wird, wie Gespräche geführt werden und wie Entscheidungen vorbereitet und getroffen werden.
Für die Praxis wirft das eine naheliegende Frage auf: „Reicht es nicht, Erwartungsmanagement zu betreiben – also klar zu sagen, was zu erwarten ist und was nicht?“ Die Erfahrung zeigt: Nein. Denn Erwartungen in Organisationen sind nicht bloß individuelle Vorstellungen, die sich einfach “verkünden” lassen und durch Kommunikation korrigierbar sind. Sie sind kollektiv verankert, widersprüchlich, über Strukturen stabilisiert und durch Routinen immer wieder bestätigt. Genau deshalb wird die Einführung von OKRs zu einem organisationalen Veränderungsvorhaben, auch wenn es auf der Oberfläche „nur“ wie eine neue Methode aussieht.
Ein Beispiel
Ein Unternehmen führt OKRs ein, um die Strategieumsetzung zu verbessern. Die offizielle Ansage lautet: „Wir wollen mehr Transparenz schaffen und besser zusammenarbeiten.“ Die bestehenden Routinen und Erwartungsmuster sehen jedoch anders aus: Ziele werden bislang so formuliert, dass sie auf jeden Fall erreichbar sind – weil sie später in Leistungsbeurteilungen einfließen. Führungskräfte bewerten Ergebnisse zudem am Jahresende in vertraulichen Runden. In diesem Gefüge wirkt die Einführung von OKRs wie eine Störung: Plötzlich sollen Ziele ambitioniert gesetzt, sichtbar geteilt und regelmäßig überprüft werden. Damit verschiebt sich die Grammatik des Entscheidens und Kommunizierens – nicht nur formal, sondern im alltäglichen Handeln.
Solche Veränderungsvorhaben sind riskant, weil sie eingespielte Routinen irritieren: Stabilität geht verloren, Orientierung wird infrage gestellt. Zugleich liegt in dieser Irritation ein produktiver Moment, weil sie Verständigung ermöglicht, die den Umgang mit Zukunft offener und reflektierter machen kann.
Die Zumutung verschobener Gewissheiten
OKRs stiften genau solche neuen Formen der Verständigung: über Ziele, Prioritäten, Fortschritt. Das ist ihre Stärke – und zugleich ihre Zumutung. Denn jede neue Verständigung verschiebt das, was bisher als selbstverständlich galt. Ein Team, das bislang operativ orientiert war, soll plötzlich an Zukunftsfragen mitwirken. Eine Führungskraft, die es gewohnt war, Entscheidungen im vertrauten Kreis zu treffen, soll sich nun mit mehreren Teams synchronisieren.
Solche Verschiebungen bleiben nicht folgenlos. Sie erhöhen die Sichtbarkeit von Zielen und Ergebnissen, steigern den Erwartungsdruck und machen Unterschiede unübersehbar, die zuvor verborgen blieben. Was vorher implizit war, wird explizit gemacht – und damit zum Gegenstand gemeinsamer Beobachtung, Aushandlung und Bewertung.
So treten Spannungen zutage, die vorher nur unterschwellig wirksam waren:
- zwischen Vision und Alltag,
- zwischen Anspruch und Machbarkeit,
- zwischen Kontrolle und Vertrauen.
Diese Spannungen sind nicht Ausdruck von Fehlern, sondern strukturell notwendig. Organisationen bewegen sich immer in solchen Doppelbindungen: Sie müssen etwa zugleich stabil bleiben, um arbeitsfähig zu sein, und instabil werden, um Neues möglich zu machen. OKRs lösen diese Spannungen nicht, aber sie machen sie sichtbar. Und genau darin liegt ihre eigentliche Bedeutung: Sie verwandeln latente Erwartungsdifferenzen in gemeinsame Gesprächsanlässe.
OKRs sind kein Heilsversprechen, sondern ein Gesprächsangebot
Organisationen, die OKRs einführen, verfolgen in der Regel bestimmte Ziele – und damit verbundene Erwartungsbilder. Vier Motive tauchen besonders häufig auf:
1. Strategie wirksam umsetzen und Fokus schaffen
OKRs sollen Aufmerksamkeit bündeln, also den Schritt ermöglichen vom „alles ein bisschen“ hin zu wenigen, strategisch relevanten Ergebnissen. Im Kern wirken sie dabei als Entscheidungsprämissen: Sie markieren, welche Themen mehr Aufmerksamkeit erhalten und welche in den Hintergrund treten und verschieben damit die Wahrscheinlichkeit künftiger Entscheidungen.
Risiko: Wenn zu viele Objectives parallel laufen oder Key Results nur alte KPIs umetikettieren, entsteht Scheinfokus – die erwartete Entlastung bleibt aus.
2. Zusammenarbeit jenseits von Silos koordinieren
OKRs können dazu beitragen, Bereiche horizontal zu koppeln: durch gemeinsame Ziele, abgestimmte Abhängigkeiten und sichtbare Beiträge. Damit irritieren sie die reine „Linienlogik“ und können eine Orientierung an Wertströmen oder Kundenerfahrungen wahrscheinlicher machen.
Risiko: Ohne abgestimmte und verbindliche Kadenzen und Foren (z. B. Alignment- oder Review-Formate) droht Meeting-Inflation: Es entstehen viele Gesprächsanlässe, die Austausch erzeugen, ohne jedoch eine neue Richtung zu eröffnen – und damit eher Belastung als Orientierung schaffen.
3. Transparenz und Lernrhythmus etablieren
OKRs schaffen einen Takt: Quartalsweise Ausrichtung, regelmäßige Reviews, Retrospektiven. Damit werden Zeitstrukturen neu gesetzt und mit ihnen Erwartungen an Fortschritt, an Kurskorrektur und an gemeinsames Lernen.
Risiko: Wenn Reviews zu reinen Statusrunden verflachen, entsteht Transparenz ohne Wirkung. Vieles wird sichtbar, doch kaum etwas davon findet Eingang in künftige Entscheidungen – Orientierung geht verloren, statt gestärkt zu werden.
4. Individuelle Performance messen (häufig, aber problematisch)
Nicht selten werden OKRs als Instrument zur Beurteilung einzelner Mitarbeitender genutzt. Das ist verbreitet – und häufig dysfunktional. Sobald OKRs mit Vergütung oder Karriereentscheidungen verknüpft werden, verschieben sich Erwartungen so, dass Risikovermeidung wahrscheinlicher wird: Ziele werden vorsichtiger gesetzt, Kennzahlen taktisch optimiert, und das Lernen verliert an Attraktivität.
Besser: OKRs als Rahmen für Teams und Organisation nutzen – für Orientierung, Lernen und Ausrichtung. Die Reflexion individueller Leistung sollte davon getrennt erfolgen: nicht über die Logik der OKRs, sondern etwa im Hinblick auf Rollenerwartungen, die Entfaltung relevanter Kompetenzen und den Beitrag zum Funktionieren gemeinsamer Wertschöpfung.
Alle vier Motive sind nachvollziehbar und zeigen doch: OKRs werden oft mit sehr unterschiedlichen Erwartungen aufgeladen. Manche davon lassen sich realisieren, andere führen fast zwangsläufig zu Enttäuschung. So eignen sich OKRs nicht zur Leistungsbewertung einzelner Mitarbeitender. Und sie können nicht automatisch aus Silos Teamwork machen. Sie eröffnen jedoch neue kommunikative Arenen, in denen genau diese Themen verhandelt werden können.
OKRs als Kommunikationsform über Zukunft
Wer OKRs lediglich als Management-Tool versteht, unterschätzt ihre Wirkung. Sie erzeugen keine Realität durch Ansagen oder Kontrolle, sondern durch geteilte Erwartungen. In diesem Sinne wirken sie nicht als Technik, sondern als Kommunikationsform: Sie verschieben Aufmerksamkeit, machen Spannungen sichtbar und eröffnen Verständigungsräume, in denen Erwartungen nicht nur fortgeschrieben, sondern bewusst verändert werden können.
Greifbar wird das in konkreten Praktiken: Wenn Teams ihre Ziele quartalsweise sichtbar machen, wenn Führungskräfte in Reviews gemeinsam mit Mitarbeitenden Kurskorrekturen diskutieren oder wenn Bereiche ihre Abhängigkeiten in Alignment-Runden abstimmen. Solche Formate sind nicht bloß Meetings, sie sind strukturierte Angebote, Zukunft im Heute verhandelbar zu machen.
Was tatsächlich von OKRs zu erwarten ist
OKRs machen Organisationen nicht berechenbarer oder einfacher. Doch sie helfen, die entscheidenden Fragen zu stellen: Worum geht es uns eigentlich? Welche Richtung wollen wir einschlagen? Welche Spannungen gilt es bewusst auszuhalten, statt sie vorschnell zu verdrängen oder kleinzureden?
Sie machen Organisationen nicht automatisch effizienter. Aber sie können strategisches Arbeiten zu einem gemeinsamen Gespräch machen – quer durch Bereiche, Ebenen und Perspektiven.
Und sie versprechen keine Sicherheit. Doch sie können uns stärken, klug und mutig mit Unsicherheit umzugehen. Vorausgesetzt, OKRs werden nicht als starrer Fahrplan verstanden, sondern als Kompass, der Orientierung gibt und zugleich Offenheit bewahrt für Umwege, Zwischentöne und gemeinsames Ringen um Richtung.
So verstanden, sind OKRs weniger ein Werkzeugkasten der Steuerung als ein Resonanzraum: Sie lassen die vielen Stimmen einer Organisation hörbar werden und machen darin jene Zukunft zum Thema, die sich erst noch entfalten muss.