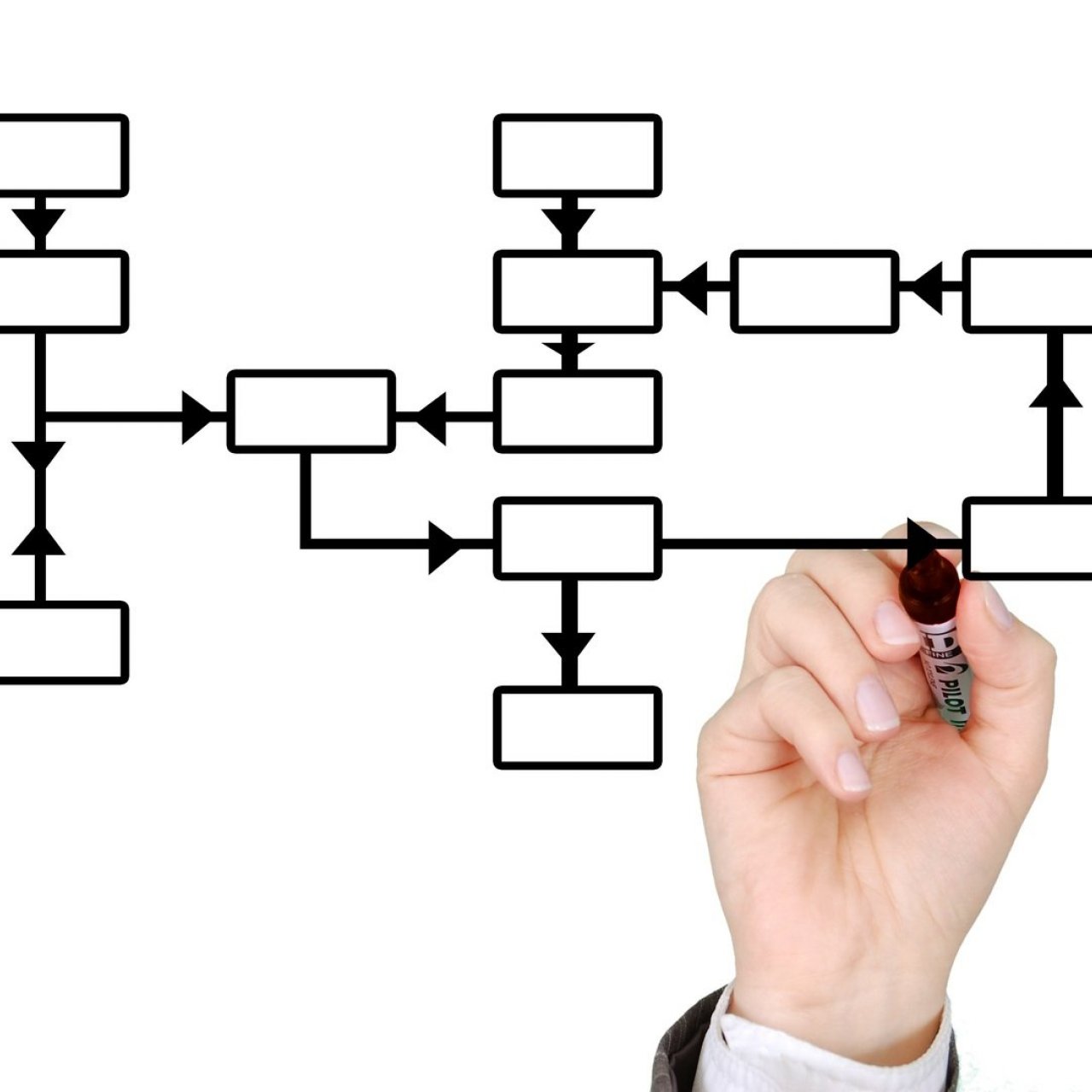Kommunikation von harten Wirklichkeiten
Nicht jede Veränderung fühlt sich wie ein Aufbruch an. Gerade bei strategischen Neuausrichtungen, Personalabbau oder Standortschließungen geraten Organisationen unter Druck. Unsicherheit, Angst und Enttäuschung prägen das Erleben vieler Beteiligter. In solchen Momenten entscheidet nicht allein die sachliche Notwendigkeit einer Maßnahme, sondern vor allem die Art und Weise der Kommunikation darüber, ob Vertrauen erhalten bleibt oder verloren geht. Aus meiner Erfahrung in der Begleitung vieler Change Vorhaben beginnt bereits hier die wichtige Arbeit, denn Kommunikation wird zu großen Teilen lediglich auf gesprochenes oder geschriebenes Wort reduziert.
Wenn Change-Kommunikation als Zumutung empfunden wird, liegt das oft daran, dass die alltägliche Wirklichkeit der Organisation, nicht mehr mit dem kommunizierten Bild übereinstimmt. Insbesondere wenn Geschäftsmodelle kippen, Restrukturierungen notwendig werden oder tiefgreifende strategische Wendungen anstehen, stehen Führungskräfte vor einem Dilemma: Wie konsequent verändern, ohne Menschen zu verlieren?
Change-Kommunikation ist immer eine Gratwanderung
Change-Kommunikation muss widersprüchliche Erwartungen ausbalancieren und gleichzeitig funktional bleiben. Sie soll informieren, beruhigen, klären und gleichzeitig Offenheit für das Ungewisse schaffen. Denn in allen Veränderungssituationen gibt es einen Leerraum zwischen dem Alten (was nicht mehr gilt) und dem Neuen (was eben noch nicht wirklich da ist). Change-Kommunikation beginnt nicht beim Formulieren von Botschaften oder dem Gedanken daran, wie man Mitarbeitenden die Ängste nehmen sollte, sondern beim Verstehen der Spannungsfelder und Dilemmas im Organisationssystem.
Veränderung setzt Organisationen eben immer vor den folgenden Widerspruch: Stabilität ist nötig, um arbeitsfähig zu bleiben; gleichzeitig braucht es Destabilisierung, um Neues zu ermöglichen. Diese „Doppelbindung“ ist kein Führungsfehler, sondern strukturell notwendig. Wenn darüber nicht keine Kommunikation stattfindet und wenn Spannungen nicht transparent gemacht werden, entsteht Misstrauen. Gleichzeitig können nicht alle Spannungen transparent gemacht werden, da dies sonst zu umfassender Destabilisierung führen kann.
Change-Kommunikation und die Schauseite
Organisationen bauen mit der Zeit eine sogenannte Schauseite auf – ein konsistentes Bild von sich selbst, das auch nach innen wirkt. Wenn dieses Bild durch notwendige Veränderungen ins Wanken gerät, das heißt die Schauseite zu bröckeln beginnt werden Spannungen beobachtbar: Beispielsweise wenn das Leitbild die Fürsorge für Mitarbeitende betont, aber Entlassungen notwendig werden. Diese Diskrepanz muss kommunikativ bearbeitet werden, denn Vertrauensverluste sind hier eine notwendige Folge.
In Organisationen kommunizieren vor allem Strukturen
Organisationen sind keine Maschinen, sondern komplexe Netzwerke von Kommunikation über Erwartungen und Erwartungsbildung. Dabei ist entscheidend: Kommunikation besteht nicht nur aus gesprochenen oder geschriebenen Worten, sonst wären Organisationen nicht wachstumsfähig. Organisationen kommunizieren Erwartungen über Strukturen und Strukturen kommunizieren Erwartungen. Jede Regel, jede Dienstanweisung, jedes Meeting ist eine strukturelle Kommunikation einer Erwartungshaltung der Organisation. Angebotene Kommunikationsformate, die Ausgestaltung von Entscheidungsprozessen oder die Formulierung von Zielvorgaben – all das sendet Botschaften. Und auch Führungskräfte sind über ihre Rolle Struktur der Organisation – erst so lässt sich erklären, warum es einen gewaltigen Unterschied macht, ob z.B. der Pressesprecher oder die Geschäftsführung eine Rückmeldung zur einem wichtigen Thema gibt.
Ich begleite seit vielen Jahren Führungskräfte in der Change-Kommunikation und insbesondere der Aspekt, dass vor allem Strukturen kommunizieren, hilft ihnen beim Verstehen und Navigieren in emotional aufgeregten Phasen.
Ein Beispiel aus der Praxis: Eine Führungskraft sagt in einem Mitarbeitendenforum „In dieser Phase geht es uns vor allem um die Menschen hier, denn ihr macht das Unternehmen aus“, um Vertrauen zu stärken. Kurz darauf wird eine neue Strategie veröffentlicht, in der klar erkennbar ist, dass Profitabilität oberste Priorität hat und ungeklärt bleibt, ob alle Jobs erhalten bleiben. Die zweite Botschaft wäre, anshclussfähig kommuniziert, wahrscheinlich tragbar gewesen. Die Diskrepanz entsteht nicht aus der Priorität selbst, sondern aus dem Widerspruch zwischen dem gesagten und dem strukturell sichtbar gewordenen.
Hier zeigt sich die hohe Relevanz des systemtheoretischen Verständnisses von Kommunikation Luhmanns: Kommunikation geschieht nicht nur durch reine zwischenmenschliche „gesagte“ Mitteilungen, sondern immer im Zusammenhang mit der Ausbildung und Stabilisierung von Erwartungen. Organisationale Kommunikation ist deshalb (fast) immer Kommunikation von und über Erwartungen – und diese Erwartungen werden vor allem über strukturelle Entscheidungen und deren Gestaltung für alle Beteiligten sichtbar.
Genau dieser Überblick fehlt Kommunikationsabteilungen – und auch die beteiligten Führungskräfte verlieren ihn im Change schnell. Primat ist hier: Was die Mitarbeitenden real als Regeln, Kommunikationsstrukturen und Rollenerwartungen – in aller Widersprüchlichkeit – erleben ist entscheidend!
Change Kommunikation und Führung
Und gerade in Umbrüchen verschärfen sich die bestehenden Spannungen zwischen Effizienz und Beziehung, Kontrolle und Vertrauen, rechtlich Notwendigem und emotionaler Realität- sprich der Einsicht, dass die Notwendigkeiten der Organisation und die Bedürfnisse der Mitarbeitenden nicht per se deckungsgleich sind.
In der Systemtheorie Luhmanns ist Kommunikation ein sozialer Vorgang, der aus drei Selektionen besteht:
- Mitteilung: Was wird gesagt?
- Information: Was ist gemeint?
- Verstehen: Was wird verstanden?
Führung bedeutet dann nicht – und vor allem nicht, Probleme sofort zu lösen – sonst landet man im Aktionismus, sondern Räume anzubieten und zu halten, in dem Unterschiede und Widersprüche sichtbar, besprechbar und bearbeitbar werden und das gemeinsame Verstehen befördert wird.
Beispiel aus der Praxis:
Ein Sozialträger, der sich als gemeinwohlorientiert versteht, muss aus wirtschaftlichen Gründen Standorte schließen. Die bisherige Kommunikation über Fürsorge und Verlässlichkeit (die auch so von der Organisationsleitung „gemeint“ war) steht im Widerspruch zur erlebten Realität. Wenn dies nicht benannt wird, entsteht eine tiefgreifende Störung. Change-Kommunikation, die dieses Spannungsfeld offen adressiert, schafft neue Anschlussfähigkeit.
Eine neue dialogische Arena kann entstehen, wenn Folgendes gelingt:
- Mitteilung: Wir sehen, dass unser Selbstbild unter Druck geraten ist;
- Information: Unsere ökonomischen Notwendigkeiten stehen im Spannungsverhältnis zu unseren bisherigen Werten;
- Verstehen: Wir wollen gemeinsam herausfinden, wie wir Haltung und Handeln neu zusammendenken, und danach handeln.
Change-Kommunikation heißt, Kommunikationsräume zu schaffen, in denen diese drei Ebenen mitgeführt und bearbeitet werden. Denn Organisationen verändern sich, wenn sich die Kommunikation ändern – Mitarbeitende sind hier Antennen, wie die neuen Kommunikationsangebote, z.B. in Form neuer Ziele, Arbeitsweisen oder Dienstvorgaben in ihrer Alltagspraxis wirken. Wenn sich die Organisation „blind bzw. immun“ für die Wahrnehmung der Mitarbeitenden machen, oder schlicht keine Werkzeuge zur Verfügung hat , diese rauszufiltern und darauf angemessen kommunikativ zu reagieren, dann wird Kommunikation in harten Veränderungen zu einer zusätzlichen Belastungsprobe mit entsprechenden (meistens nicht kalkulierten ) Kosten. Wer Kommunikation nur als rhetorische Disziplin versteht, wird in komplexen Kontexten scheitern.