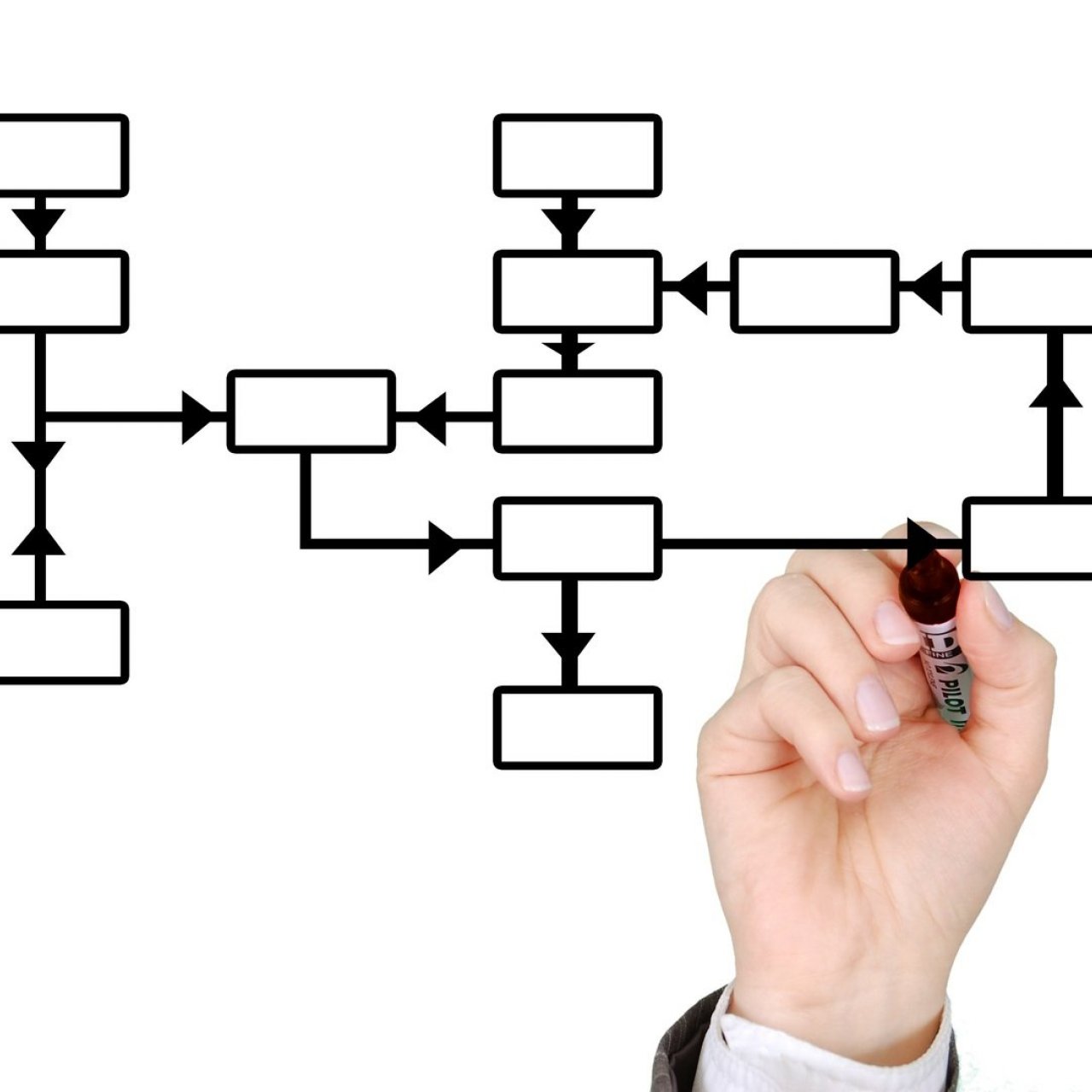Damit ein Leitbild nicht zur Falle wird
Kaum ein Instrument wird in Organisationen so oft missverstanden wie das Leitbild. Es soll Orientierung bieten, Sinn stiften, Zusammenhalt fördern und Identität stärken. Gerade in Phasen des Wandels oder nach Umbrüchen wird es zum Hoffnungsträger: Ein Leitbild soll der Belegschaft Halt geben, wenn Strukturen wackeln. Es soll ein gemeinsames Bild davon bieten, wer man ist und was wichtig ist. Andererseits gibt es auch fast kein Instrument, dass so regelmäßig wegen ausbleibender Alltagswirkung kritisiert wird. Viele Führungskräfte kennen diese andere Seite: der Moment, in dem das frisch entwickelte Leitbild als Plakat an der Wand hängt und der Alltag unverändert bleibt, obwohl genau das im Prozess besonders versprochen wurde, und vielleicht auch von den beteiligten Führungskräften und Mitarbeitenden selbst erwartet wurde. Das Leitbild wurde normativ stark aufgeladen und endet dann oft mit dem Satz: „Schön formuliert, aber mit unserer Realität hat das wenig zu tun.“ Schlimmer noch, es erzeugt Unstimmigkeiten. Manche Bereiche oder Mitarbeitende erkennen sich in den Aussagen nicht wieder, andere geraten in den Rechtfertigungszwang zu erklären, warum es in ihrem Alltag zu deutlichen Abweichungen kommt. Kurzum: genau das Gegenteil dessen, was mit dem Leitbild eigentlich beabsichtigt war.
Als Reaktion darauf gilt es als Qualitätsversprechen, wenn Leitbilder operationalisiert werden – sprich mit Leben gefüllt werden. In de Folge werden Leitbilder besonders eng gehalten, mitunter so weit bis aus einem Orientierungsrahmen ein halbgares Regelwerk wird. Regelvorstellungen, die sich im Prozess schnell einschleichen und durch die Organisation gar nicht eingehalten werden können. Das Leitbild, das Freiraum und Richtung zugleich geben sollte, verwandelt sich dann in ein Korsett, das an der Realität der Organisation vorbeigeht. In solchen Fällen wünschen sich Führungskräfte häufig, dass es möglichst schnell in Vergessenheit gerät, aber die Geister, die man ruft, wird man bekanntlich nicht so leicht los. Erst recht nicht, wenn man das Leitbild als bindend postuliert hat… aber dazu im später mehr.
Leitbilder – ein häufig falsch eingeschätztes Instrument in der Führung von Organisationen
Leitbilder scheitern an den falschen Erwartungen, weil sie nicht dafür gemacht sind den Alltag zu steuern.
Die meisten Leitbilder scheitern nicht am Text, nicht am Layout und auch nicht daran, dass Mitarbeitende „sie nicht leben“. Ihr „Scheitern“ beginnt bereits viel früher, nämlich am Prozessanfang. Ob Auftraggeber oder Beratungsagenturen, man überbietet sich förmlich darin, die Umsetzbarkeit und Alltagswirkung des Leitbildes zu versprechen. Da halte ich aus rein praktischer Erfahrung dagegen und schlage vor innezuhalten. Ohne über Funktionalität und Folgen nachgedacht zu haben, läuft man Gefahr Leitbilder entgegen ihrer Funktion zu implementieren. Aber um das einzuschätzen braucht man ein Organisationsmodell, dass beschreibt, was Organisationen im Kern ausmachen – nämlich die Ausbildung und Stabilisierung von Erwartungen.
Leitbilder sind ein großartiges Instrument, um über die Schauseite der Organisation Orientierung zu schaffen.
Leitbilder dienen der Erwartungsbildung auf der Schauseite einer Organisation. Das ist nicht zufällig so, sondern folgt einer funktionalen Logik. Die Schauseite ist der Teil der Organisation, an dem sie sich selbst beschreibt, oft in einer Form, die widerspruchsfreier wirkt, als es der operative Alltag tatsächlich ist, und auf Grund der Arbeitsteilung und daraus entstehenden unterschiedlichen Logiken und Notwendigkeiten (dazu mehr unter folgendem Artikel), zwingend sein muss. Diese Selbstbeschreibung ist notwendig, weil Organisationen auf unterschiedliche Erwartungen, unterschiedlich reagieren müssen. Sie ziehen aber Spannungen nach sich. Erwartungen von Mitarbeitenden, Führungskräften, politischen Gremien, Kund:innen, der Öffentlichkeit oder regulatorischen Instanzen, auf der Schauseite werden diese Erwartungen in einer Form gebündelt, die verständlich und anschlussfähig für (fast) alle ist.
Wichtig ist: Die Schauseite ist kein funktionsloses Bühnenbild, sie erfüllt eine zentrale Funktion. Sie übersetzt die Komplexität der Organisation in eine Verständigungsform, die Orientierung ermöglicht. Darin liegt ihr eigentlicher Nutzen. Stefan Kühl (Kühl, 2016) bezeichnet Leitbilder deshalb als Wertekataloge, oder aus unserer Sicht als strukturierte Selbstbeschreibung, die nicht regeln, sondern deuten.
Ein Wertekatalog sagt: „So möchten wir verstanden werden“, nicht: „So musst du handeln.“ Diese Unterscheidung ist wesentlich, denn sie trennt die Funktion der Schauseite von der Funktion der formalen Seite. Während auf der formalen Seite entschieden ist, wer wofür verantwortlich ist und welche Prozesse verbindlich gelten, beschreibt die Schauseite, wie die Organisation ihre eigenen Prinzipien, Haltungen und Zuschreibungen interpretiert. Sie sind bindend im Sinne der Selbstbeschreibung, nicht im Sinne von konkreten Vorschriften. Sie definieren den Rahmen, in dem Verhalten interpretiert wird, aber nicht die Handlung selbst.
Folgendes Beispiel verdeutlicht das:
Wenn eine Organisation im Leitbild festhält, dass sie „verantwortungsvoll“ handelt, dann beschreibt sie damit eine normative Orientierung, sie legt fest, dass Verantwortung wichtig ist. Aber sie definiert nicht, wie genau Verantwortung zu übernehmen ist, in welcher Situation welche Form angemessen wäre oder wer wann Verantwortung delegieren darf. Das wird auf der der formalen und auch informalen Seite beobachtbar. Die informale Seite wiederum füllt diese Strukturen mit gelebter Praxis.
Wenn also Auftraggeber Leitbilder nicht auf der Schauseite verorten, sondern als formales Instrument zweckentfremdet sehen, entsteht sofort ein Problem für alle. Ein Leitbild kann keine Prozessbeschreibungen ersetzen, keine Rollen definieren, keine operativen Zielkonflikte auflösen.
Vorschlag für einen Leitbildprozess aus der Praxis, der hält was er verspricht
Ich starte mit einer Hypothese. Die Qualität eines Leitbildes wird weniger durch das Ergebnis (Dokument), sondern vielmehr durch den Prozess bestimmt. Leitbildprozesse dienen dazu in einem gewissen Rahmen Mitarbeitende in Kontakt mit realen Spannungsfeldern der Organisation zu bringen. Und das ohne, dass daraus sofort ein Action Item oder eine formale Ableitung geschieht.
In Leitbildanfragen haben wir daher für uns einen simplen Überprüfungsmechanismus entwickelt. Unsere Kunden hören von uns stets die Frage: Für welches ungelöste Problem soll das Leitbild eine Lösung bieten? Daraus können wir Hypothesen entwickeln, welcher Auftrag hier im Raum steht und ob dieser unserer Beschreibung von Leitbildern entspricht. In diesem Klärungsprozess liegt für unsere Kunden ein großer Nutzen, denn sie verstehen ihre Lösungsvorstellungen und können für sich prüfen, ob dieser intensive Leitbildprozess wirklich beauftragt werden soll und welche Folgediskurse durch den Leitbildprozess ausgelöst werden sollen.
Im Folgenden skizziere ich diesen Prozess modellhaft.
1. Schritt: Rahmen und Funktion klären
In diesem Schritt wird geklärt, welche Funktion das Leitbild erfüllen soll. Dadurch finden zwei zentrale Aspekte Raum. Einerseits werden Erwartungen sichtbar und gleichzeitig können diese im Hinblick auf das Leistungsversprechen eines Leitbildes überprüft werden. In dieser Phase wird auch geprüft wer letztlich Adressat:in des Leitbildes sein wird, wie universell das Leitbild gültig sein soll und wie man die Adressat:innen im Prozess beteiligen will. Nochmal zur Erinnerung, der Diskurs kann der große Gewinn in einem Leitbildprozess sein, vor allem wenn es darum geht schwerwiegende Themen in der Organisation zu platzieren. In diesem Schritt wird auch geklärt, welche Arbeitsgruppe sich mit dem Leitbild befasst und damit federführend diesen Prozess treibt.
2. Schritt: Sondierungen und Identifikation möglicher Leitbildthemen
Bleibt die Leitbildentscheidung bestehen, dann stellt sich jetzt die Frage, welche Themen für das Leitbild in Frage kommen. Hier wird der Grundstein für die Passung Leitbild-Organisation gelegt. Einzigartige Leitbilder entstehen dort, wo die Spannungsfelder der konkreten Organisation Raum bekommen. Hier geht es nicht darum Spannungen wie Qualität vs. Geschwindigkeit weg zu moderieren oder künstlich zu kaschieren, sondern sie als Grundspannung der Organisation zu verstehen. Meiner Erfahrung nach entstehen hier auch häufig erste Narrative, die für das spätere Leitbild relevant werden.
3. Schritt: Prototypen entwickeln
Jetzt gilt es einen Prototypen zu entwerfen. Das bedeutet, dass erste Leitbildnarrative entwickelt werden, aber auch bestimmte Spannungsfelder offengelassen, für die es noch keine leitbildartige Angleichung gibt und die möglicherweise auch nicht in das fertige Leitbild übernommen werden.
4. Schritt: Prototypen in den Kontakt mit den zukünftigen Kunden (der Organisation) bringen und weiter verfeinern
Ob und wie das Leitbild zur Organisation passt, entscheidet die Organisation, nicht die Arbeitsgruppe, die das Leitbild federführend erarbeitet. Das heißt konkret: jetzt gilt es Feedback einzusammeln und Kontakt mit dem Leitbild herzustellen. Hier geht es auch nicht darum, das Leitbild gegen jeden Widerstand durchzuboxen, sondern wachsam auf die eingebrachte Wahrnehmung der Adressat:innen zu achten. Dieser Prozess hat zudem eine weitere Funktion. In dem das Leitbild als Entwurf eingebracht wird, ist allen klar, dass daran noch gearbeitet wird und die Ersteller:innen des Leitbildes erhalten Feedback zu erwartbaren Kritikpunkten, auch wenn diese für das zukünftige Leitbild beibehalten werden.
5. Ausformulieren und weitere Strukturen in den Blick nehmen
Jetzt wird das Leitbild ausformuliert und erhält den redaktionellen Feinschliff. In dieser Phase beginnen wir meistens mit unseren Kunden weitere Antworten für aufgekommene Themen zu entwickeln, für die es strukturell andere Antworten braucht.
Leitbildarbeit muss das Spannungsfeld zwischen Klarheit und Offenheit bewusst gestalten, nicht auflösen.
Ich habe weiter einen reflektierten Leitbildprozess in Ansätzen zu beschreiben. Dabei möchte ich nochmal folgenden Unterschied auf den Punkt bringen: Ein unreflektierter Leitbildprozess versucht, einen künstlichen Konsens herzustellen („Wir vertrauen…Punkt.“). Ein reflektierter Prozess der das Leitbild dort verortet, wo es wirken kann lässt anderes agieren zu: "Wir vertrauen, und wir kontrollieren dort, wo die Organisation es verlangt." Beides gehört zusammen. Die Ambivalenz wird nicht kaschiert, sondern benannt und gestaltet.
Leitbildarbeit wird dann produktiv, wenn sie diese Differenzen sichtbar macht und bearbeitbar hält. Sie schafft keinen Konsens, sondern eine gemeinsame Sprache für Unterschiede. Dadurch entsteht Orientierung, die tragfähig ist, gerade in Situationen, in denen klare Vorgaben fehlen.
Fazit: Leitbilder als Orientierung ohne Regel
Organisationsklug eingesetzt entfalten Leitbilder eine Wirkung, die weit über das hinausgehen kann, was man einem Dokument zutrauen würde. Ihre Bedeutung liegt nicht in der Steuerung des Alltags, und schon gar nicht in der Festlegung konkreter Verhaltensregeln. Ihr Wert entsteht dort, wo Organisationen am seltensten Zeit investieren: in Verständigung, Selbstbeobachtung und gemeinsames Deuten der eigenen Praxis.
Ein Leitbild wirkt nicht deshalb, weil es „gelebt“ wird, sondern weil sein Entstehungsprozess die Organisation in eine Art kollektive Selbstreflexion führt. Ein gut geführter Leitbildprozess zwingt die Beteiligten, über ihre Erwartungen, Spannungsfelder und Widersprüche zu sprechen – und zwar in einer Offenheit, die im Tagesgeschäft kaum möglich ist und dort auch Fehl am Platz wäre. Damit schult er eine Fähigkeit, die für komplexe Organisationen essenziell ist: die Kompetenz, sich selbst zu beobachten und zu verstehen, wie man Entscheidungen trifft, wie Führung funktioniert und wie man mit Unterschieden umgeht. Ihre eigentliche Leistung entsteht im gemeinsamen Ringen um Bedeutung. Dieser Prozess macht sichtbar, was sonst unausgesprochen bleibt: unterschiedliche Rollenlogiken, divergierende Erwartungen, lokale Rationalitäten (Silos). Erst durch diese Verständigung entsteht ein Orientierungsrahmen, der tragfähig ist, weil er an der organisationalen Realität ansetzt.
So verstanden wird das Leitbild zu einem Führungsinstrument, das weniger durch den Text wirkt als durch die Dialogfähigkeit, die sein Prozess erzeugt. Es etabliert eine Form der Verständigung, die Organisationen befähigt, in komplexen Situationen handlungsfähig zu bleiben. Und es schult die Selbstbeobachtung, die notwendig ist, um in dynamischen Umwelten nicht nur Entscheidungen zu treffen, sondern sie auch verorten zu können.
Quellenhinweise
- Bild von Pxhere
- Kühl, S. (2016). Leitbilder erarbeiten: Eine kurze organisationstheoretisch informierte Handreichung. Springer VS.
- Sehr viel eigene Praxiserfahrung